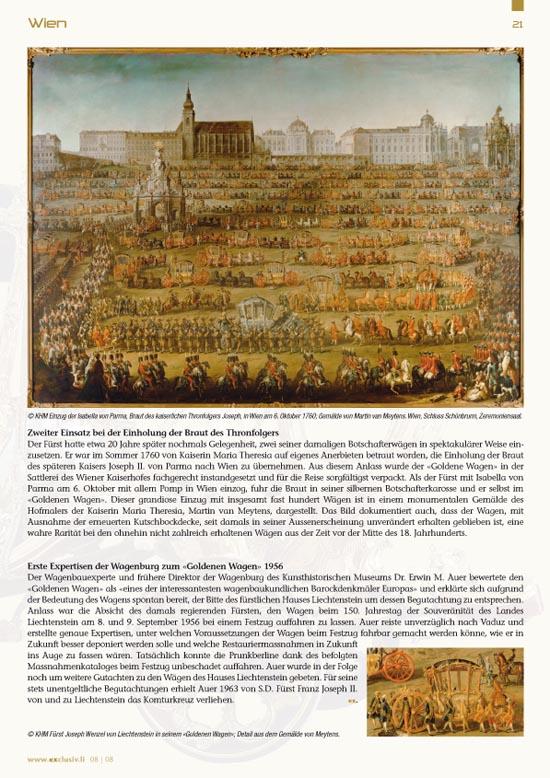
Wien
Der Goldene Wagen
der Fürsten Liechtenstein
Nicolas Pineau (1684-1754) Der Goldene Wagen des Fürsten Joseph Wenzel
I. von Liechtenstein, 1738 2003 neu aufgestellt in der Sala Terrena des
Gartenpalais Liechtenstein © Sammlungen des Fürsten von und zu
Liechtenstein, Vaduz-Wien
Ein Zeugnis barocker Prachtentfaltung und kooperativer Denkmalerhaltung.
Der «Goldene Wagen», der sich heute im
«Liechtenstein Museum» in Wien befindet, dokumentiert zum einen die
jahrhundertelange enge Beziehung der beiden Fürstenhäuser Liechtenstein
und Habsburg. Zum anderen ist er auch ein Beispiel gelungener
kollegialer Hilfestellung bei der Erhaltung historischer
Kulturdenkmäler fern von Profitabsicht und Konkurrenzdenken.
Entstehung und erster Gebrauch des «Goldenen Wagens»
Der «Goldene Wagen» wurde 1737/38 von Fürst Joseph Wenzel von
Liechtenstein, dem Botschafter Kaiser Karls VI. am französischen Hof,
in Auftrag gegeben. Er diente für dessen feierlichen Einzug als
Botschafter am 21. Dezember 1738 in Paris und zwei Tage später in
Versailles. Dabei waren insgesamt fünf Wägen des Fürsten beteiligt, und
zwar zwei Karossen, ein Kaross-Coupé und zwei Berlinen. Von diesen
beiden Berlinen ist nur mehr eine, eben der «Goldene Wagen» erhalten.
In ihr fuhren der Sekretär und der Pagenhofmeister des Fürsten, also
Dienstpersonal. Der Fürst selbst sass übrigens in keinem seiner fünf
Wägen, sondern in einem Leibwagen des französischen Königs Ludwig XV.
Wer dieses Wagenensemble entwarf, lässt sich schriftquellenmässig nicht
belegen. Stilistische Eigenheiten weisen aber auf den Innenarchitekten
und Ornamentschnitzer Nicolas Pineau (1684-1754), der ab 1732 in Paris
beim Bau mehrerer «hôtels» (Adelswohnsitze) und Prunkwägen beteiligt
war. Auch der Maler der Paneeltafeln des «Goldenen Wagens» mit den die
vier Jahreszeiten und vier Elemente darstellenden Putten ist nicht
überliefert; er dürfte dem Atelier des galanten Rokokomalers Francois
Boucher zuzuordnen sein.
Die Bezeichnung «Goldener Wagen» stammt erst aus der zweiten Hälfte des
19. Jahrhunderts, als vergoldete Wägen bereits eine Besonderheit
darstellten. Zuvor hiess er entsprechend seiner ersten Verwendung
«vierter Botschafterwagen», weil er als vierter Wagen des Ensembles
beim feierlichen Einzug von 1738 auffuhr.
© KHM Detail von der Paneelmalerei des «Goldenen
Wagens» eines namentlich nicht überlieferten Malers.
© KHM Einzug der Isabella von Parma, Braut des kaiserlichen
Thronfolgers Joseph, in Wien am 6. Oktober 1760; Gemälde von Martin van
Meytens. Wien, Schloss Schönbrunn, Zeremoniensaal.
Zweiter Einsatz bei der Einholung der Braut des Thronfolgers
Der Fürst hatte etwa 20 Jahre später nochmals Gelegenheit, zwei seiner
damaligen Botschafterwägen in spektakulärer Weise einzusetzen. Er war
im Sommer 1760 von Kaiserin Maria Theresia auf eigenes Anerbieten
betraut worden, die Einholung der Braut des späteren Kaisers Joseph II.
von Parma nach Wien zu übernehmen. Aus diesem Anlass wurde der «Goldene
Wagen» in der Sattlerei des Wiener Kaiserhofes fachgerecht
instandgesetzt und für die Reise sorgfältigst verpackt. Als der Fürst
mit Isabella von Parma am 6. Oktober mit allem Pomp in Wien einzog,
fuhr die Braut in seiner silbernen Botschafterkarosse und er selbst im
«Goldenen Wagen». Dieser grandiose Einzug mit insgesamt fast hundert
Wägen ist in einem monumentalen Gemälde des Hofmalers der Kaiserin
Maria Theresia, Martin van Meytens, dargestellt. Das Bild dokumentiert
auch, dass der Wagen, mit Ausnahme der erneuerten Kutschbockdecke, seit
damals in seiner Aussenerscheinung unverändert erhalten geblieben ist,
eine wahre Rarität bei den ohnehin nicht zahlreich erhaltenen Wägen aus
der Zeit vor der Mitte des 18. Jahrhunderts.
Erste Expertisen der Wagenburg zum «Goldenen Wagen» 1956
Der Wagenbauexperte und frühere Direktor der Wagenburg des
Kunsthistorischen Museums Dr. Erwin M. Auer bewertete den «Goldenen
Wagen» als «eines der interessantesten wagenbaukundlichen
Barockdenkmäler Europas» und erklärte sich aufgrund der Bedeutung des
Wagens spontan bereit, der Bitte des fürstlichen Hauses Liechtenstein
um dessen Begutachtung zu entsprechen.
Anlass war die Absicht des damals regierenden Fürsten, den Wagen beim
150. Jahrestag der Souveränität des Landes Liechtenstein am 8. und 9.
September 1956 bei einem Festzug auffahren zu lassen. Auer reiste
unverzüglich nach Vaduz und erstellte genaue Expertisen, unter welchen
Voraussetzungen der Wagen beim Festzug fahrbar gemacht werden könne,
wie er in Zukunft besser deponiert werden solle und welche
Restauriermassnahmen in Zukunft ins Auge zu fassen wären. Tatsächlich
konnte die Prunkberline dank des befolgten Massnahmenkataloges beim
Festzug unbeschadet auffahren. Auer wurde in der Folge noch um weitere
Gutachten zu den Wägen des Hauses Liechtenstein gebeten. Für seine
stets unentgeltliche Begutachtungen erhielt Auer 1963 von S.D. Fürst
Franz Joseph II. von und zu Liechtenstein das Komturkreuz verliehen.
© KHM Fürst Joseph Wenzel von Liechtenstein in seinem «Goldenen Wagen»; Detail aus dem Gemälde von Meytens.